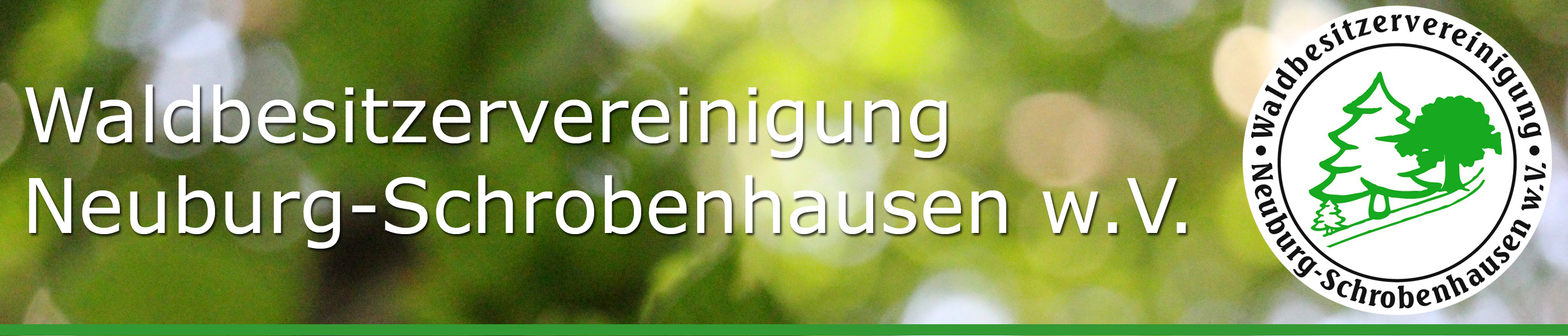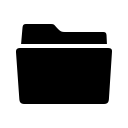
Waldpolitik (24)
Bayerischer Waldpakt von Kaniber und Söder unterschrieben

Schweiz: WSL sieht Holz als Joker bei der Energiewende
Während die Bundesregierung Brennholz als nicht mehr erneuerbare Energiequelle betrachtet, veröffentlichen unsere schweizerischen Nachbarn eine Studie mit gegensätzlichen Ergebnissen.

Die WSL (Eidg. Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft) sieht Holz als Trumpf in der Energiewende. Dies liege daran, dass es sehr vielseitig und gut speicherbar ist. Dabei sei nicht nur die Energie in Form von Wärme, sondern auch als Elekrizität und Treibstoff eine mögliche Nutzung. Ein weiteres großes Plus sei die zeitlich unbegrenzte Verfügbarkeit, was Holz klar von Sonnen- und Windenergie unterscheide. Nun wurde von der WSL untersucht, wie sich diese Bioenergie am besten in das schweizerische Energiesystem eingebettet werden können.
Der ganze Bericht kann hier nachgelesen werden: Holz - Ein Joker für die Energiewende
Verbot von Holz energie im Neubau - weitgehende Verhinderung im Bestand
Das Bundeskabinett hat gestern den Entwurf eines Gebäudeenergiegesetzes (GEG) verabschiedet. Biomasseheizungen im Neubau, also auf Basis von Holz in Form von Pellets, Hackschnitzeln und Scheitholz sollen zur Erfüllung des 65 Zieles von erneuerbaren Energien im Heizungsbereich verboten werden. Für den Heizungstausch im Bestand bleibt Holz als Rohstoff zulässig, allerdings nur in Kombination mit Solarenergie, Pufferspeicher und dem Einbau staubmindernder Techniken. Im Neubau wird damit die Zentralheizung mit Holz oder Pellets verboten und im Bestand erheblich verteuert und erschwert.

In vielen Fällen darf ein Waldbesitzer Energieholz aus sei nem eigenen Wald nicht mehr zur Beheizung seines eigenen Hauses verwenden“ so Josef Ziegler, der Präsident des Bayerischen
Waldbesitzerverbandes, als erste Reaktion auf den Kabinettsbeschluss. Dieser Kabinettsbeschluss ist deshalb ein Schock für die 500.000 Waldbesitzerfamilien in Bayern. In den nächsten Jahrzehnten muss der Hauptteil unserer vorratsreichen Fichten und Kiefernwälder umgebaut werden Im Zuge des anstehenden Baumartenwechsels fallen große Mengen an Nebenprodukten an, für die künftig kaum noch Verwertungsmöglichkeiten bestehen. Einnahmen fallen weg, die dringend für die Kosten des Waldumbaus benötigt werden.
"In Zukunft entsteht das CO2 im Wald durch natürliche Verrottung. Dieser Gesetzentwurf verlangsamt die Anpassung unserer Wälder an ein wärmeres Klima. Ein ganz schlimmer Vorschlag im Hinblick auf den Klimaschutz“ so Ziegler. Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer die Landwirte und die ländliche Bevölkerung werden sich das nicht bieten lassen und breiten Widerstand gegen diese Pläne leisten.
Pressemitteilung des Bayersichen Waldbesitzerverbandes vom 20.04.2023
Anträge zur Waldbewirtschaftung und Holznutzung abgelehnt
Der Bundestag hat am Donnerstag, den 26.01 je einen Antrag der CDU/CSU und einen Antrag der AfD abgelehnt. Im Antrag der CDU/CSU mit dem Titel "Die wertvollen ökologischen Leistungen unserer Wälder anerkennen und ein entsprechendes Vergütungssystem für Waldbewirtschaftung schaffen" ging es um die marktgerechte Vergütung der vielfältigen Ökosystemleistungen. Diese sollte Anreiz bieten bestehende Waldflächen zu pflegen, zu erhalten und zu nutzen, sowie neue Waldflächen anzulegen um diese anschließend in die Bewirtschaftung aufzunehmen. Der AfD-Antrag "Hemische Holzenergie mobilisieren - Importabhängigkeit des deutschen Wärmemarktes reduzieren" wurde ebenfalls abgelehnt. Im Vorschlag sollten für Klein- und Privatwaldbesitzer Maßnahmen erarbeitet werden um Holz effektiver als bisher zu nutzen.

Weitergehende Informationen zum Antrag und die entsprechenden Dokumente sind hier zu finden: Deutscher Bundestag - Anträge zur Waldbewirtschaftung und Holznutzung abgelehnt
Wärme und Energie aus Waldholz künftig nur zweitklassig?
Mitteilung des bayerischen Waldbesitzerverbandes zur Veröffentlichung:
Weitere Verhandlungen zur Erneuerbare-Energien-Richtlinie müssen Irrweg des Europäischen Parlaments stoppen
Das EU-Parlament hat vergangene Woche über die neue Richtlinie für erneuerbare Energien (RED III) verhandelt. Dabei ging es auch um die Frage, ob Holz und insbesondere Waldholz künftig noch als nachhaltiger Energieträger anerkannt wird. Im Vorfeld hatte bereits der Umweltausschuss mehrheitlich dafür votiert, dem Waldholz die Anerkennung als erneuerbare Energie zu entziehen. Dies ist ein politischer Angriff auf die Wahrheit.
Zunächst die gute Nachricht: Holz bleibt bis 2030 "erneuerbare Energie". Künftig soll aber für Biomasse aus dem Wald - eine maximale Nutzungsmenge eingeführt werden. Die Energiemenge aus Waldholz soll nicht die durchschnittliche Menge der Jahre 2017 bis 2022 überschreiten. Diese Grenze gilt allerdings nicht, wenn das Holz aus Kalamitätsnutzungen wie z.B. aus der Borkenkäferbekämpfung oder aus Vorsorgemaßnahmen in Waldbrandhochrisikogebieten stammt.

Nachwachsendes Energieholz aus regulärer Nutzung wird damit diskriminiert. Vor dem Hintergrund des drängenden Waldumbaus – einfach verheerend. Das wäre der Einstieg in den Ausstieg für die Wärme aus dem Wald .
In der EU wird die regionale Verfügbarkeit von geringwertigen Nebenprodukten der Waldnutzung zur dezentralen Wärmeerzeugung weiterhin sehr unterschiedlich sein. Der dringend notwendige Wechsel der Baumarten im Zuge der Klimaanpassung der Wälder, wird räumlich und zeitlich unterschiedlich, eine höhere Verfügbarkeit des Rohstoffes entstehen lassen. Das heißt, wir brauchen maximale Flexibilität für die erneuerbare Ressource Holz.
Deshalb ist es sinnvoll und zwingend, Holzsortimente, für die es wenig alternative Verwendung gibt, als Energieträger einzusetzen, um damit fossile Energieträger zu ersetzen. Das leuchtet jedermann ein. Das Europäische Parlament diskriminiert mit seiner Unterscheidung in primäre und sekundäre Biomasse die Holz-Sortimente, die im Zuge nachhaltiger Waldbewirtschaftung anfallen. Denn "sekundäre Biomasse" sollen Holznebenprodukte aus der industriellen Verarbeitung wie z.B. Späne oder Resthölzer sein. Nur das ist also die „gute Biomasse“, weil sie nicht direkt aus dem Wald gewonnen wird. Verstehen muß man das nicht. Aber dagegen scharf protestieren.
„Als Vertreter von rund 700.000 Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer in Bayern sehen wir diese Einführung von Energieholz 2. Klasse und die Pläne, dem Waldholz nach und nach die Anerkennung als erneuerbare Energie abzuerkennen, mit großer Sorge. Wir lehnen dies strikt ab.“
Holzenergie ist in Deutschland mit Abstand die wichtigste erneuerbare Energiequelle (etwas über ein Drittel) und ist gerade für die Wärmewende unverzichtbar:
Von den aktuell lediglich 16,5 % erneuerbarer Wärme beruhen drei Viertel auf Holz, davon sind etwa die Hälfte geringwertige Nebenprodukte direkt aus dem Wald. Die andere Hälfte sind Nebenprodukte der Holzindustrie. . Aus dem Wald kommt dabei Holz aus Pflege- und Durchforstungsmaßnahmen, Kronenrestholz oder Kalamitätsholz. Diese Biomasse stammt aus nachhaltiger Waldwirtschaft und ist als nachwachsender Rohstoff erneuerbar. Einige politische Akteure wollen jetzt diese Realität mit politischen Entscheidungen zu Fall bringen. Das wäre wahrheitswidrige Politik, gegen die wir entschieden vorgehen müssen.
Es ist zu hoffen, dass sich die Diskussion in den anstehenden Trilogverhandlungen der EU, also den Verhandlungen zu RED III zwischen der EU-Kommission, dem EU-Rat und dem EU-Parlament, wieder an der Realität orientiert. Unser heimisches Energieholz ist eine erneuerbare Ressource, die für die Energiewende unverzichtbar ist. Nun sind die Mitgliedsstaaten gefordert, diesen Angriff auf die Wahrheit zu beenden.
Bayerischer Waldbesitzerverband e.V.
Unter dem folgenden Link finden Sie wertvolle und weitere Informationen der LWF zur energetischen Holzverwendung.
https://www.lwf.bayern.de/forsttechnik-holz/holzverwendung/312036/index.php
Pressemitteilung des bayerischen Waldbesitzerverbandes zur Veröffentichung per Email am 27.09.2022
Foto: Pixabay ohne Bildnachweis
Waldbewirtschaftung - Wer soll die Kosten tragen?

Die Waldbewirtschaftung wird teurer. Die letzten Jahre waren durch Wetterextreme und Kalamitäten geprägt und das bei gleichzeitig gestiegenen Ausgaben für Holzernte, Waldpflege und -schutz. Die LWF Bayern hat nun im Projekt "Soziokulturelles Waldmonitoring Bayern" versucht herauszufinden wer aus Sicht der Bevölkerung in Zukunft die Waldbewirtschaftsungskosten tragen soll und welche Ziele bei Verwendung von öffentlichen Mitteln verfolgt werden sollen.
Der gesamte Bericht hierzu findet ihr unter folgendem Link: Waldbewirtschaftung – wer soll die Kosten tragen? - LWF aktuell 135
Bilder: Pixabay ohne Bildnachweis
Aktionsprogramm: Natürlicher Klimaschutz
Das Aktionsprogramm "Natürlicher Klimaschutz" wurde von Bundesumweltministerin Steffi Lemke am 29.03.22 in Berlin vorgestellt. Hierfür sind im Zeitraum von 2022 -2024 4 Mrd € vorgesehen. Auch der Schutz von Waldökosystemen soll dabei gefördert werden. Das Programm wurde auch im Koalitionsvertrag festgelegt.

Folgend der Auszug aus dem Eckpunktepapier hinsichtlich des Punktes "Waldökosystem":
Gesunde Wälder können große Mengen an CO2 einbinden. Eine Ausdehnung der Waldflächen erhöht diese Senkenfunktion langfristig. Sie schafft zudem wertvolle Lebensräume und trägt zum Ziel der EU-Biodiversitätsstrategie 2030 und der EU-Waldstrategie bei, in Europa drei Milliarden Bäume zusätzlich zu pflanzen. Durch die Mehrung der Waldfläche soll die Vielfalt der Landschaft und die Lebensraumqualität für viele Arten erhöht werden, die Biotopvernetzung verbessert und positive Effekte auf das Lokalklima sowie den Landschaftswasserhaushalt erzielt werden.
Die letzte Bundeswaldinventur von 2012 weist nur 36 Prozent der Waldfläche in Deutschland als naturnah aus. Durch den gezielten Umbau bestehender, nicht naturnaher Wälder und die Wiederbewaldung geschädigter Waldflächen können sich naturnahe Waldökosysteme entwickeln. Deren Biodiversität und Strukturreichtum sind Grundvoraussetzung für die Klimaanpassungsfähigkeit und die Resilienz von Wäldern. Naturnahe Waldökosysteme verbessern außerdem den Wasserhaushalt in der Landschaft.
Wir werden unter Federführung des BMEL gemeinsam ein Anreizsystem schaffen, um naturnahe Waldumbaumaßnahmen, Aufforstungen und natürliche Waldentwicklung gezielt zu fördern, sowie auch die bodenschonende Waldbearbeitung. Öffentliche Wälder werden eine Vorreiterrolle bei der Entwicklung hin zu naturnahen, klimaresilienten und nachhaltig bewirtschafteten Wäldern einnehmen. Wir wollen Maßnahmen ergreifen, um den Einschlag in alten, naturnahen Buchenwäldern in öffentlichem Besitz zu stoppen.
Das gesamte Aktionspapier kann hier eingesehen werden: Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz
Bildnachweis: Johannes Plenio auf Pixabay
Förderung von Hackschnitzel und Pelletheizungen - Neues Förderprogramm
Durch die Errichtung von Biomasseheizwerken soll ein Beitrag zur Umsetzung des Bayerischen Energieprogramms, des Bayerischen Aktionsprogramms Energie und zum Klimaschutz geleistet werden. Mit den geförderten Projekten sollen jährlich mindestens 5.000 Tonnen Kohlendioxid eingespart werden.

Antragsberechtigt sind:
- Natürliche Personen
- Juristische Personen des Privatrechts
- Personengesellschaften
- Kirchliche Einrichtungen und juristische Personen des öffentlichen Rechts der mittelbaren Landes- und Bundesverwaltung mit eigener Rechtsträgerschaft (insbesondere kommunale Gebietskörperschaften, Anstalten, Stiftungen, Kammern)
Fördergegenstand
1. Investitionen in neue, umweltschonende Biomasseheizwerke zur effizienten energetischen Nutzung fester Biomasse mit einer Nennwärmeleistung von mindestens 60 Kilowatt
Unterlagen zur BioKlima-Antragstellung (Biomasseheizwerke von mind. 60 kW)
2. Investitionen in neue, umweltschonende Biomasseheizsysteme mit einer Nennwärmeleistung von mindestens 60 Kilowatt, deren Wärme in ein Wärmenetz eingespeist wird, in das auch Abwärme und/oder Solarenergie eingespeist wird. Der Anteil der Abwärme bzw. solarer Wärme am Jahres-Wärmeenergiebedarf muss mindestens zehn Prozent betragen.
-
Vor Antragstellung ist eine Projektbesprechung am TFZ erforderlich.
-
Mit dem Vorhaben darf vor Bewilligung nicht begonnen werden. Als Vorhabenbeginn gilt bereits der Abschluss eines der Ausführung zuzurechnenden Lieferungs- oder Leistungsvertrages.
-
Planungsleistungen dürfen vor Antragstellung erbracht werden.
Nur geringe Schäden in Bayerns Wäldern durch Orkantiefs
Die Orkantiefs der vergangenen Tage haben in Bayerns Wäldern insgesamt keine schwerwiegenden Schäden angerichtet. Das hat Forstministerin Michaela Kaniber nach einer ersten Schadensbilanz in München mitgeteilt. Bayernweit wurden überwiegend einzelne Bäume und kleinere Gruppen umgeworfen. Lediglich in den Wäldern der Hochlagen und der Mittelgebirge haben die Stürme deutlichere Spuren hinterlassen – schwerpunktmäßig im Nordosten Bayerns in den Landkreisen Hof, Wunsiedel, Tirschenreuth, Kronach und teilweise im Landkreis Rhön-Grabfeld. Insgesamt ist die bayernweit durch den Sturm angefallene Holzmenge gering, sodass keine Störungen auf dem bayerischen Holzmarkt zu erwarten sind.

Auch in den nächsten Tagen soll es windig bleiben. Kaniber warnt deshalb auch weiterhin dringend vor dem Betreten der Wälder: „Es herrscht noch immer Lebensgefahr im Wald, denn es können jederzeit Äste abbrechen oder ganze Bäume umfallen!“ Auch für die anstehenden Aufräumarbeiten nach dem Abklingen der Stürme ruft die Ministerin zu äußerster Vorsicht auf. „Die Aufarbeitung von Sturmholz ist sehr gefährlich und sollte immer professionell begleitet werden“, so Kaniber. Häufig sei der unterstützende Einsatz von Holzerntemaschinen die sicherste Arbeitsweise. Professionelle Beratung und Hilfe finden die Waldbesitzer bei den Ämtern für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten sowie bei den forstlichen Zusammenschlüssen.
Übersichtskarte über das Ausmaß der Orkanschäden in Bayerns Wäldern
Forstliches Gutachten 2021 - Regionale Ergebnisse liegen vor
Alle drei Jahre erstellt die bayerische Forstverwaltung forstliche Gutachten for die bayerischen Hegegemeinschaften. Dabei äußert sich die Fortsverwaltung zum Zustand der Waldverjüngung und ihrer Beeinflußung durch Schalenwildverbiss und Fegeschäden. Die Ergebnisse der diesjährigen Erhebung liegen nun vor und sind auch für die Wälder aus unserem WBV-Gebiet verfügbar. Dabei sind diese nach den einzelnen Hegegemeinschaften, z.B. Schrobenhausen und Ehekirchen aufgeteilt und ermöglichen so einen genauen Blick in die Wälder im eigenen Bereich. Es liegt jeweils das Gutachten, die Auswertung und eine Zusatzauswertung vor.
Die Ergebnisse könnt ihr hier finden: Forstliches Gutachten zur Situation der Waldverjüngung 2021

weitere...
Walzustandserhebung des Forstministeriums veröffentlicht
Jedes Jahr führt das Bayerische Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten die sogenannte Waldzustandserhebung durch. Hier fließen vor allem auch die Beantwortung forstpolitischer Fragen ein. So z.B. zur Risikoabschätzung der Folgen des Klimawandels oder zur Rolle der Wälder als Kohlenstoffsepeicher. Die Waldzustandserhebung (früher bekannt als Kronenzustandserhebung) ergänzt die periodisch stattfindenden Inventuren, wie z.B. die Bundeswaldinventur.

Die Ergebnisse der Erhebung wurden als Bericht zusammengefasst und sind hier zum Download eingestellt: Ergebnisse der Waldzustandserhebung 2021
Bildnachwies: Bild von lefteye81 auf Pixabay
Wissenschaftlicher Beirat bestätigt BMEL-Waldpolitik
Gutachten zur Anpassung von Wäldern an den Klimawandel vorgelegt – Bundesministerin Klöckner: Schutz der Wälder und weitere Nachhaltigkeitsmaßnahmen müssen Kernvoraussetzung zukünftiger Handelsabkommen werden

Wälder sind unsere Klimaschützer Nummer eins. Doch durch die Folgen des Klimawandels sind sie existenziell gefährdet. Deshalb ist ihre Anpassung an den Klimawandel die wichtigste Aufgabe, vor der die Waldpolitik heute steht. Zu diesem Schluss kommt auch der Wissenschaftliche Beirat für Waldpolitik des Bundesministeriums in seinem Gutachten, das der Vorsitzende Prof. Dr. Jürgen Bauhus heute in Berlin an Bundeswaldministerin Julia Klöckner MdB übergeben hat.
Darin empfehlen die Wissenschaftler eine aktive Bewirtschaftung der Wälder in Deutschland, Nichtstun sei keine Option. Das Gutachten unterstützt damit die Waldpolitik des Bundesministeriums. Angesichts von mittlerweile 280.000 Hektar Schadfläche, die wiederbewaldet werden muss, hatte Bundesministerin Julia Klöckner mit 1,5 Milliarden Euro das größte ökologische Waldumbauprogramm in der Geschichte Deutschlands gestartet. Auf mehreren Tausend Hektaren wurden bereits überwiegend reine Laubwälder und Mischwälder mit einem hohen Anteil von Laubbäumen neu begründet, die standortangepasst und klimastabil sind.
Bundesministerin Julia Klöckner: "Die nachhaltige Wiederbewaldung und Waldanpassung sind die Schlüsselaktivitäten im Kampf für einen Klimaschutz mit Wald. Unsere Maßnahmen haben wir daher immer eng mit den Praktikern und der Wissenschaft abgestimmt. Dieser Ansatz wird jetzt nochmal bestätigt – dem Wissenschaftlichen Beirat danke ich für die Beratung und seine Arbeit. Gleichzeitig zeigt das Gutachten, dass wir auch mit unserer Waldstrategie 2050 die richtigen Leitplanken setzen, um den Wald mit seinen vielfältigen Funktionen für die kommenden Generationen zu erhalten. Dazu gehört auch, dass wir diejenigen langfristig unterstützen, die unseren Wald als maßgeblichen Klimaschützer erhalten, pflegen und bewirtschaften. Insofern ist auch die Erklärung der Weltklimakonferenz, die Entwaldung bis 2030 zu stoppen, ein wichtiger und gleichzeitig längst überfälliger Schritt im globalen Kampf gegen den Klimawandel. Ich halte es zudem für notwendig, dass ein solches Verbot der Abholzung und weitere Nachhaltigkeitsstandards zu den Kernvoraussetzungen zukünftiger Handelsabkommen gehören."
Prof. Dr. Jürgen Bauhus, Vorsitzender des Beirats: "Unsere Empfehlungen zielen darauf ab, die Vielfalt der Ökosystemleistungen langfristig sicherzustellen. Dafür benötigen wir einerseits resiliente und anpassungsfähige Wälder und andererseits Betriebe und Institutionen, die in der Lage sind, diese Daueraufgabe der Anpassung zu bewerkstelligen."
Zentrale Handlungsempfehlungen des Beirates
- Resiliente und anpassungsfähige Wälder erhalten und entwickeln
- Den Waldschutz gegenüber biotischen Risiken verbessern
- Risikomanagement zum Umgang mit Extremereignissen weiterentwickeln
- Biodiversität sichern und erhöhen
- Boden und Wasser schützen
- Nachhaltige Holzverwendung fördern
- Wälder als Orte für Erholung, Sport und Tourismus entwickeln
- Ökosystemleistungen honorieren
- Monitoring optimieren
- Forschungskapazitäten stärken, besser vernetzen und neu ausrichten
Zentrale Handlungsfelder der Waldstrategie 2050 des Bundesministeriums
Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel
- Die Beratung, Planung und Durchführung von Maßnahmen zur Anpassung der Wälder an den Klimawandel wird mit entsprechenden Programmen staatlich gefördert.
- Die Klimaschutzleistung der Wälder muss honoriert werden: Ein System des Bundesministeriums liegt vor.
- Da der Klimawandel dynamisch ist, müssen auch Programme angepasst werden: Deshalb wird ein zentrales Klimawandel-Monitoring für den Wald etabliert.
Biodiversität
- Mit der Strategie soll die als naturnah eingestufte Waldfläche weiter ausgebaut werden (aktuell: 76 Prozent). Dafür wird ein Konzept für Waldnaturschutz entwickelt.
- Es wird ein Monitoring aufgesetzt, das Fortschritte und Nachsteuerungsbedarf bei der Biodiversität ermittelt.
Nachhaltige Waldbewirtschaftung
- Ziel ist, die Holzbauquoten beim Neubau von Wohnungen auf 30 Prozent anzuheben. Gerade die öffentliche Hand muss hier eine Vorbildfunktion einnehmen.
Erholungsort und Bewusstsein
-
Bewusstsein für und Wissen über den Wald werden geschaffen über:
- Bundeswaldtage und andere Veranstaltungsformate,
- die "Bundesplattform Wald – Sport, Erholung und Gesundheit",
- und über das Kompetenz- und Informationszentrum Wald und Holz.
Das Gutachten kann hier heruntergeladen werden.
Hintergrund:
Der Wissenschaftliche Beirat für Waldpolitik (WBW) berät und unterstützt die Bundesregierung bei der Gestaltung der Rahmenbedingungen für eine nachhaltige Bewirtschaftung der Wälder. Der Beirat ist mit Vertretern verschiedener wissenschaftlicher Fachdisziplinen besetzt, die die gesellschaftlichen Anforderungen an den Wald widerspiegeln. Der Beirat prüft die Ziele und Grundsätze der nationalen und internationalen Waldpolitik. Er unterbreitet Vorschläge für die Weiterentwicklung der waldpolitischen Rahmenbedingungen und der Instrumente zur Umsetzung der Waldstrategie 2020 der Bundesregierung. Darüber hinaus bemüht er sich um einen Ausgleich zwischen den verschiedenen gesellschaftlichen Ansprüchen an den Wald und fördert den wissenschaftlichen Diskurs über eine nachhaltige, multifunktionale Bewirtschaftung der Wälder.
Klöckner stellt Waldstrategie 2050 vor
Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner hat heute die Nationale Waldstrategie 2050 des Ministeriums gemeinsam mit Prof. Dr. Andreas Bolte, Leiter des Instituts für Waldökosysteme am Thünen-Institut, vorgestellt.

Die Strategie befasst sich mit der Anpassung der Wälder an den Klimawandel, der nachhaltigen Waldbewirtschaftung und der dauerhaften Speicherung von CO2 in Holzprodukten sowie der Erhaltung des Waldes als Erholungsort. Darüber hinaus soll in der Bevölkerung ein Bewusstsein für den Wert des Waldes geschaffen werden.
Alle Akteure mitnehmen
Der Wald sei Klimaschützer, Hort der biologischen Vielfalt, Arbeitgeber und Erholungsort. All diese Funktionen wolle man stärken und für die kommenden Generationen erhalten, sagte Julia Klöckner.
Andreas Bolte ergänzte, die Wiederbewaldung und Waldanpassung seien die Schlüsselaktivitäten im Kampf für einen Klimaschutz mit Wald. Dafür brauche man die richtige Forschung und Entwicklung. Und es sei wichtig, alle Akteure gleichermaßen mitzunehmen. Die Waldstrategie zeige den Weg dahin.
Handlungsfelder
Wesentliche Handlungsfelder der Nationalen Waldstrategie 2050 sind Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel, Biodiversität, Nachhaltige Waldbewirtschaftung sowie Erholungsort und Bewusstsein
Beim Punkt Klimawandel sollen Waldbesitzer bei der Anpassung der Wälder an den Klimawandel mit entsprechenden Programmen staatlich gefördert werden. In Gegenzug zur Bepreisung von CO2 sollen Klimaschutzleistungen der Wälder honoriert werden. Und es soll ein zentrales Klimawandel-Monitoring für den Wald etabliert werden.
In puncto Biodiversität soll die als naturnah eingestufte Waldfläche weiter ausgebaut werden. Dafür wird ein Konzept für Waldnaturschutz entwickelt. Förderung und Monitoring sollen die Maßnahmen flankieren.
Unter dem Punkt Nachhaltige Waldbewirtschaftung wird als Ziel die Erhöhung der Holzbauquote auf 30 % genannt. Die öffentliche Hand müsse hier eine Vorbildfunktion einnehmen.
Bewusstsein für und Wissen über den Wald sollen Bundeswaldtage und andere Veranstaltungsformate schaffen, ebenso wie die „Bundesplattform Wald – Sport, Erholung und Gesundheit“ und das Kompetenz- und Informationszentrum Wald und Holz (KIWuH).
Reaktionen
Erwartungsgemäß loben die Forstverbände die Nationale Waldstrategie 2050, da die Holznutzung klar im Mittelpunkt steht. Georg Schirmbeck, Präsident den Deutschen Forstwirtschaftsrates warnte davor, den Biodiversitätsschutz über den hohen Wert der Holznutzung für den Klimaschutz zu stellen. Die Familienbetriebe Land du Forst begrüßen, ebenso wie Schirmbeck, den Einstieg in die die Honorierung der Ökosystemleistungen des Waldes. Der beste Klimaschutz entstehe durch nachhaltige Forstwirtschaft, sind sich die beiden Verbände einig.
Lediglich die AGDW kritisiert bei genereller Zustimmung, die Waldbesitzer und ihre Unterstützung stünden bei der Strategie nicht genügend im Mittelpunkt.
Die Umweltverbände sparen dagegen nicht mit Kritik. Der WWF bezeichnet die Strategie als eine peinliche Mogelpackung, die eher einem inhaltsleeren Wahlwerbespot gleiche als einer echten, substanziellen Strategie. Der BUND meint, Klöckner erweise mit der Waldstrategie 2050 dem deutschen Wald einen Bärendienst. Von einer ökologischen Waldwende fehle in der neuen Strategie jede Spur. Beide Verbände kritisieren, dass das Bundesumweltministerium an der Entwicklung der Waldstrategie nicht beteiligt wurde. Angesichts der großen Bedeutung des Waldes und seiner vielfältigen Funktionen sei es „unpassend“ und „ein schweres Versäumnis“, dass ein einzelnes Ministerium eine Waldstrategie veröffentliche.
Der Bericht, sowie die Strategie zum Download gibt es hier: Waldbericht 2050
Waldbericht der Bundesregierung 2021

- die bestehende Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ (GAK) und
- das Konjunktur- und Krisenbewältigungspaket der Bundesregierung, über die Bundeswaldprämie, das Investitionsprogramm Wald, das Investitionsprogramm Holzwirtschaft und das Förderprogramm Klimafreundliches Bauen mit Holz.